Allgemein passive Prothesen aktive Prothesen elektrische Prothesen Aufbau Methodik Schaftformen Bauteile Steuerungsvarianten
Was ist das?
Armprothesen dienen als Ersatz bei Amputationen oder Dysmelien zur Herstellung einer Greiffunktion oder des Erscheinungsbildes. Sie können bedarfsweise an- und abgelegt werden und werden für jeden Anwender individuell gefertigt.
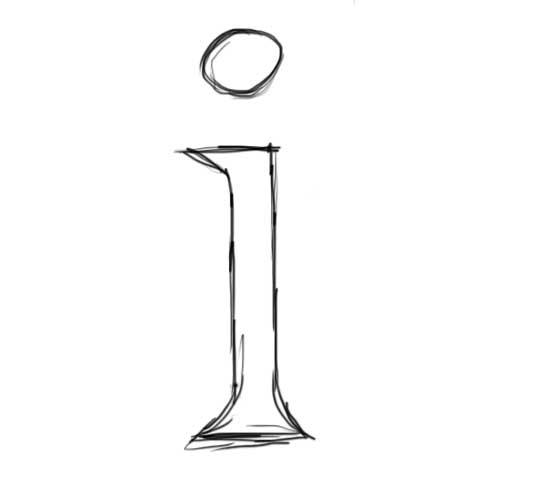
Armprothesen werden von außen an den Körper herangebracht und anders als Endoprothesen nicht implantiert. Sie umschließen idealerweise nur den Stumpf und maximal ein angrenzendes Gelenk. Sie können bedarfsweise an- und abgelegt werden.
Der Anspruch an das Hilfsmittel ist erfahrungsgemäß hoch, die technischen Möglichkeiten meist fern von der Wunschvorstellung und die individuellen Voraussetzungen sehr unterschiedlich. Daher kann jede Prothese nur individuell für einen Anwender hergestellt werden um präzise auf seine Bedürfnisse abgestimmt werden zu können und die Kompromisse zwischen Anspruch und Möglichkeiten so gering wie möglich zu halten. Dieser Vorgang dauert meist einige Wochen und setzt eine enge persönliche Zusammenarbeit zwischen Anwender und Techniker voraus.
Kosten und Kostenübernahme
Die Kosten für eine Armprothese hängen von der Ausführung und den Anforderungen an die Prothese ab. In Deutschland sind Armprothesen über die Sozialkassen abrechnungs- bzw. erstattungsfähig.

Im deutschen Sozialrecht sind Armprothesen Leistung der gesetzlichen Krankenversicherungen und werden von diesen grundsätzlich übernommen. Eine der Grundlagen dafür ist das Sozialgesetzbuch IX welches die Bedingungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen regelt. Im Sinne der Inklusion sollen behinderte Menschen durch Hilfsmittelversorgungen soweit rehabilitiert werden, dass sie möglichst uneingeschränkt und selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen können. Der aktuelle Stand der Technik ist dabei zu berücksichtigen.
Hilfsmittelversorgungen müssen dabei ausreichend, wirtschaftlich und zweckmäßig erfolgen. Diese rechtliche Formulierung lässt einen Interpretationsspielraum zu, wobei aus Sicht von Leistungserbringern und Anwendern typischerweise folgende zusammengefasste Sichtweise gilt:
- ausreichend ist das Hilfsmittel, wenn es den Bedürfnissen und Anforderungen des Anwenders gerecht wird.
- wirtschaftlich ist das Hilfsmittel, wenn der entstandene Aufwand sinnvoll eingesetzt wird und das Hilfsmittel bestimmungsgemäß genutzt werden kann.
- zweckmäßig ist das Hilfsmittel, wenn seine Nutzung die uneingeschränkte Teilhabe ermöglicht.
Dies stellt keine Rechtsberatung dar.
Welche Prothese zu welchem Zeitpunkt?
Ab dem ersten Lebensjahr ist die Patschhand eine Option. Ab dem Laufradalter kann eine Lenkhilfe unterstützen. Ab etwa dem vierten Lebensjahr wird eine funktionelle elektrische Prothese empfohlen. Der Beginn sollte im Idealfall vor dem Schuleintritt, dem Wechsel auf die weiterführende Schule und vor der Berufsfindungsphase erfolgen.
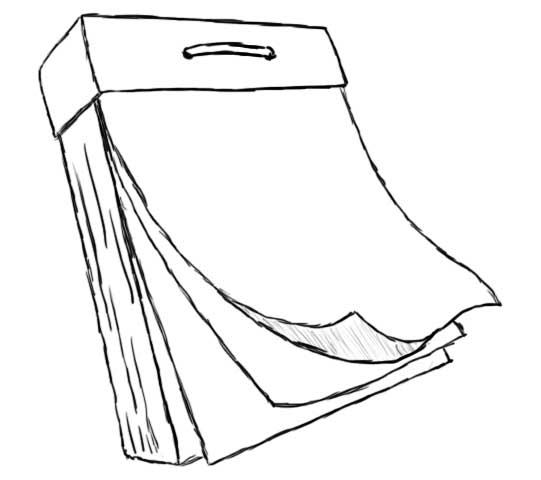
- Ab etwa einem Jahr kann die Versorgung mit einer Patschhandprothese in Erwägung gezogen werden. Diese kann den Kindern als Unterstützung hilfreich sein. Ein früherer Versorgungsbeginn muss kritisch abgewägt werden, da eine Prothesenversorgung immer auch mit Gefühlseinbußen einher geht und die sensible Entwicklung und Körperwahrnehmung besonders in den ersten Lebensmonaten von großer Bedeutung sind. Auch ist es wichtig, dass die Kinder die Chance haben Ersatzstrategien zu entwickeln, da es im späteren Versorgungsverlauf immer wieder zu Nutzungsausfällen bei der Prothese kommen kann.
- Mit etwa zwei Jahren kann eine Lenkhilfe den ersten Kontakt zu einem klar funktionsorientierten Hilfsmittel herstellen, wodurch das Kind sich in der Abwägung zwischen Funktionszugewinn und Gefühlseinbußen zugunsten der Hilfsmittelversorgung im Allgemeinen orientieren kann.
- Mit etwa vier Jahren ist ein günstiger Zeitpunkt für den Einstieg in funktionelle elektrische Prothesen. Die geistige Reife erleichtert den Zugang für den Techniker, die Fähigkeit das Geschehen zu verstehen kann aber auch zur Akzeptanz der Versorgung beitragen.
- Sofern eine funktionelle elektrische Versorgung im Alter von vier Jahren noch nicht gewünscht ist, bietet sich das Jahr vor der Einschulung an. Mit dem Schuleintritt prasselt eine Vielzahl neuer Eindrücke und Anforderungen auf das Kind ein, daher empfiehlt es sich den Aufwand einer Erstversorgung mit entsprechendem Training und der Eingewöhnung aus dieser Zeit herauszuziehen und im besten Falle die Funktionsvorteile einer Prothese bereits geübt in die Schule mit einzubringen.
- Dasselbe gilt in Bezug auf den Zeitraum vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule, auf der mit neuen Fächern, Lehrern und Klassenverbänden eine fokussierte Gewöhnung an die Prothese nicht den höchsten Stellenwert besitzt.
- Sollte bis hierher noch keine Entscheidung gefällt worden sein, die Absicht zu einer prothetischen Versorgung aber grundsätzlich bestehen, ist es ratsam vor Beginn der Berufsfindungsphase seine persönlichen Möglichkeiten mit und ohne Prothese auszutesten um die Funktionsvorteile in die Entscheidung einfließen lassen zu können. Auch kann eine prothetische Versorgung dazu beitragen Berührungsängste und Vorbehalte möglicher Arbeitgeber abzubauen.
Die Zeitpunkte stellen eine erfahrungsbasierte Empfehlung dar. Insbesondere der optimale Zeitpunkt für die funktionelle Erstversorgung kann variieren. Auch ist es selbstverständlich nach dem Schuleintritt oder -wechsel möglich mit einer Versorgung zu beginnen.
Gewicht
Prothesen sind meistens leichter als der physiologische Arm, Dadurch dass sie von außen angebracht werden empfinden die Anwender es dennoch anders.
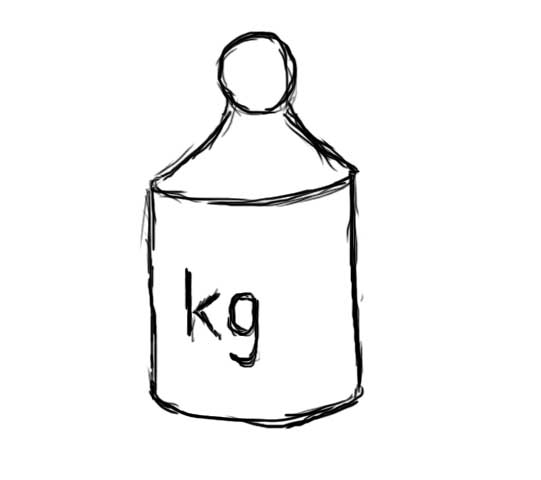
Eine Auswahl an Gewichtsangaben:
- myoelektrische Unterarmprothese mit Silikonschaft im Kindersystem: etwa 450g
- myoelektrische Unterarmprothese mit Silikonschaft, Rotationseinheit im Handgelenk und Systemhand für Erwachsene: etwa 1200g
- myoelektrische Oberarmprothese mit Silikonschaft, elektromechanischem Ellenbogengelenk und Systemhand: etwa 2300g
- myoelektrische Schulterprothese mit Silikonschaft, elektromechanischem Ellenbogengelenk und Systemhand: etwa 3600g
Die meisten Anwender bemerken wenigstens bei der ersten Versorgung ein hohes Gewicht der Prothese. Obwohl in Abhängigkeit des Versorgungsniveaus das Gewicht der Prothese unter Umständen das des physiologischen Armes unterschreiten kann, so erklärt sich das subjektiv hohe Gewicht durch die Hebelverhältnisse. Das gesamte Gewicht muss durch den vergleichsweise kurzen Stumpf geführt werden und unglücklicherweise befindet sich häufig eine der schwersten Komponenten - die Prothesenhand - am weitesten vom Stumpfende entfernt. Dass es sich um ein von außen angebrachtes Gewicht handelt, welches nicht physiologisch über Knochen und Muskulatur mit dem Körper verbunden ist, verstärkt den Effekt.
Einen umfassenden Gewichtsausgleich zugunsten einer verbesserten Körperstatik ist daher in den meisten Fällen nicht zielführend, da eine solche Belastung im Tagesverlauf kaum zu tolerieren ist. In diesem Zusammenhang ist eine verbesserte Körperstatik in Verbindung mit der Nutzung einer Prothese mutmaßlich eher auf die intensivere Nutzung der betroffenen Seite mit allen anliegenden Muskelgruppen und Bewegungssegmenten zurückzuführen.
Sofern die Gewichtsbelastung nicht toleriert werden kann, können die funktionellen Anforderungen unter Abwägung des technisch erforderlichen Gewichts neu bewertet, oder gegebenenfalls Bandagenlösungen zur Unterstützung in Betracht gezogen werden.
Haltbarkeit
Die Haltbarkeit hängt von der Ausführung, dem Nutzungsverhalten oder dem Wachstumspotential ab.

Im Sinne einer wirtschaftlichen Herangehensweise und unter Beachtung der Richtlinien der Kostenträger werden häufig Komponenten weiterverwendet, wenn dies möglich ist. So wird häufig eine reine Schaftneuanfertigung durchgeführt, während die elektromechanischen Komponenten gewartet und (beim selben Anwender) wieder eingesetzt werden. Insbesondere bei Kindern ist dies gängige Praxis, da das Wachstum hier deutlich häufigere Anpassungen und Neuanfertigungen erfordert (ca ein bis zwei Jahre, in Ausnahmefällen bereits innerhalb weniger Monate).